Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung




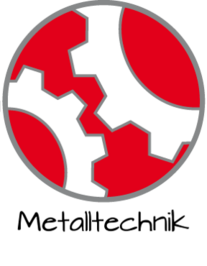
Ziel
In den Fachklassen für die einzelnen Ausbildungsberufe wird der schulische Teil einer Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung vermittelt. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den regionalen Betrieben der jeweiligen Branchen.
Unterricht
Der Unterricht ist auf den speziellen Ausbildungsberuf ausgerichtet, sowohl im berufsbezogenen Bereich als auch in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Sport/Gesundheitsförderung, Politik/Gesellschaftslehre und Religionslehre (berufsübergreifender Bereich).
Je nach Abstimmung zwischen Berufsschule und Betrieben werden die durchschnittlich 1,5 Tage Unterricht pro Woche auf einzelne Schultage oder größere Unterrichtsblöcke verteilt.
Anmeldung:
Die Ausbildung erfordert einen Ausbildungsvertrag mit einem Ausbildungsbetrieb. Dafür ist kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben, meistens wird aber ein Hauptschul- oder Realschulabschluss verlangt.
Die Anmeldung an unserer Schule übernimmt Ihr Ausbildungsbetrieb für Sie.
Ausbildungsberufe im dualen System an unserer Schule:
- Anlagenmechaniker*in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Bauzeichner*in
- Elektroniker*in für Betriebstechnik
- Elektroniker*in – Energie- und Gebäudetechnik
- Fachinformatiker*in – Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker*in – Systemintegration
- Fachinformatiker*in – Daten- und Prozessanalyse
- Fachinformatiker*in – Digitale Vernetzung
- IT-System-Elektroniker*in
- Fertigungsmechaniker*in
- Holzmechaniker*in – Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen
- Holzmechaniker*in – Möbelbau und Innenausbau
- Holzmechaniker*in – Montieren von Innenausbauten und Bauelementen
- Industriemechaniker*in
- Konstruktionsmechaniker*in
- Maler und Lackierer*in – Gestaltung und Instandhaltung
- Mechatroniker*in
- Metallbauer*in – Konstruktionstechnik
- Metallbauer*in – Metallgestaltung
- Tischler*in
- Werkzeugmechaniker*in
- Zerspanungsmechaniker*in
- Kraftfahrzeugmechatroniker*in
- Kraftfahrzeugmechatroniker*in – Nutzfahrzeugtechnik
- Kraftfahrzeugmechatroniker*in – Personenkraftwagentechnik
- Kraftfahrzeugmechatroniker*in – System- und Hochvolttechnik
- Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker*in – Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
- Bauten- und Objektbeschichter*in
- Maschinen- und Anlagenführer*in – Metall- und Kunststofftechnik
- Industrieelektriker*in – Betriebstechnik
- Fachkraft für Metalltechnik – Montagetechnik
- Fachkraft für Metalltechnik – Konstruktionstechnik
- Fachkraft für Metalltechnik – Umform- und Drahttechnik
- Fachkraft für Metalltechnik – Zerspanungstechnik
- Land- und Baumaschinenmechatroniker*in
- Verfahrenstechnolog*in Metall – Stahlumformung
und verwandte Ausbildungsberufe.
Einen guten ersten Überblick über einen konkreten Ausbildungsberuf findet man z.B. unter http://berufenet.arbeitsagentur.de
Fachklassen zum Aufklappen
Autor: Frank Lange, ESB
Anlagenmechaniker/in – Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK)
Tätigkeitsbeschreibung:
Anlagenmechanikerinnen und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik planen und installieren moderne Versorgungsanlagen in Gebäuden. Dazu gehören z. B. Wasserleitungen, Heizsysteme, Lüftungsanlagen oder umweltfreundliche Solartechnik. Sie richten Bäder ein, montieren Heizkörper, schließen Anlagen an und nehmen sie in Betrieb. Auch Wartung, Reparatur und Energieoptimierung bestehender Systeme gehören zu ihren Aufgaben.
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (duale Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule)
Einsatzorte: Baustellen, Wohnungen, Gewerbeobjekte, Technikräume – oft im direkten Kundenkontakt
Perspektiven:
Nach der Ausbildung bestehen viele Weiterbildungsoptionen, z. B. zum/zur Techniker/in, Meister/in oder in Richtung Energieberatung, Gebäudeautomatisierung oder ein Studium im Bereich Gebäudetechnik.
Anforderungen:
- Handwerkliches Geschick und Auge-Hand-Koordination
z. B. beim Verlegen und Verschweißen von Rohrleitungen oder Einbauen von Armaturen - Sorgfalt
z. B. beim Abdichten von Leitungen oder Justieren empfindlicher Mess- und Regeltechnik - Technisches Verständnis
z. B. für das Funktionsprinzip von Heizungs- und Klimaanlagen oder beim Anschließen elektrischer Komponenten - Räumliches Vorstellungsvermögen
z. B. beim Verlegen komplexer Leitungssysteme anhand von Plänen - Gute körperliche Konstitution
z. B. beim Arbeiten in beengten Räumen, auf Leitern oder mit schweren Geräten
Wichtige Schulfächer:
- Werken/Technik
z. B. für das Montieren von Bauteilen und Umsetzen von Installationsplänen - Mathematik
z. B. zum Berechnen von Rohrlängen, Wasserdruck, Heizlast oder Materialbedarf - Physik
z. B. beim Verständnis von Thermodynamik, Wasser- und Luftströmung, Energieumwandlung
Weiterführende Informationen: https://planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/BKB/15164.pdf
Ansprechpartnerin
Michael Steinrücke
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Autor: Schiller, ESB
Bauzeichner/in (Schwerpunkte: Architektur, Ingenieurbau, Tief-, Straßen- und Landschaftsbau)
Berufsbild
Bauzeichner bzw. Bauzeichnerinnen sind überwiegend in Planungsbüros und Unternehmen der Bauwirtschaft sowie in Behörden tätig. Typische Einsatzfelder sind - analog zum gewählten Schwerpunkt - der Architekturbereich, der Ingenieurbau sowie der Tief-, Straßen- und Landschaftsbau. Bauzeichner bzw. Bauzeichnerinnen arbeiten einzeln und im Team an der inhaltlichen Realisierung von Bauprojekten. Auf der Basis moderner Technologien und unter Nutzung branchentypischer Software fertigen sie Zeichnungen auf der Basis baurechtlicher Vorschriften für die Planung und Bauausführung an, auch unter den Aspekten des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Neben den zeichnerischen Tätigkeiten sind sowohl rechnerische als auch organisatorische Tätigkeiten selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildung dauert drei Jahre; eine vorzeitige Zulassung zur Prüfung nach 2,5 Jahren oder eine Verkürzung auf zwei Jahre ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Ausbildungsinhalte
Ausbildungsinhalte sind u. a.:
- Organisation und Kommunikation, Arbeitsabläufe
- Zusammenarbeit mit Behörden und anderen am Bau Beteiligten
- Techniken des Zeichnens, rechnergestütztes Zeichnen
- Auswahl und Verwendung von Baustoffen und Bauelementen
- Mitwirken bei Bauprozessen und Durchführen von Bauarbeiten
- Konstruieren von Bauteilen
- Bestandsaufnahme und Vermessung
- Erstellen von Plänen und fachspezifischen Berechnungen
Unterricht
Der Unterricht wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in vierzehn praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den drei Bündelungsfächern Bauentwurfsplanung, Baukonstruktionen und Bauausführungsplanung organisiert. Im 1. und 2. Ausbildungsjahr sind die ersten neun Lernfelder für die Bereiche Architektur, Ingenieurbau und Tief-, Straßen- und Landschaftsbau gleich. Die Unterteilung in die drei Schwerpunkte beginnt mit dem 3. Ausbildungsjahr.
Lernfelder:
- Mitwirken bei der Bauplanung
- Aufnehmen eines Bauwerkes
- Erschließen eines Baugrundstücks
- Planen einer Gründung
- Planen eines Kellergeschosses
- Konstruieren eines Stahlbetonbalkens
- Konstruieren von Treppen
- Planen einer Geschossdecke
- Entwerfen eines Dachtragwerkes
Schwerpunkt Architektur
- Erstellen eines Bauantrages
- Entwickeln einer Außenwand
- Planen einer Halle
- Konstruieren eines Dachaufbaues
- Ausbauen eines Geschosses
Schwerpunkt Ingenieurbau
- Sichern eines Bauwerks
- Entwickeln einer Aussenwand
- Planen einer Halle
- Konstruieren eines Daches
- Planen eines Stahlbetonbauwerkes
Schwerpunkt Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
- Ausarbeiten eines Straßenentwurfs
- Konstruieren eines Straßenoberbaus
- Planen einer Wasserversorgung
- Planen einer Wasserentsorgung
- Planen einer Außenanlage
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Um einen möglichst großen Praxisbezug herzustellen, findet der Fachunterricht in einem PC-Raum statt, in dem insgesamt 27 CAD-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, die mit dem Zeichenprogramm Allplan ausgestattet sind.
Besonderheiten
In jedem Jahr absolvieren mehrere Gruppen von in der Regel fünf Bauzeichnern bzw. Bauzeichnerinnen ein dreiwöchiges Auslandspraktikum in Norwegen, um dort u. a. die Holzrahmenbauweise kennenzulernen. Die Vor- und Nachbereitung der Aufenthalte erfolgt durch die Stiftung Bildung und Handwerk in Paderborn, die die Praktika im Rahmen von Erasmus+ auch finanziell fördert.
Ansprechpartnerin
Karin Linkamp-Buddensiek
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
Autor: Jens Fischer
Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
Berufsbild
In der Ausbildung zum/zur Elektroniker/-in in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik erlernst du, wie moderne Technologien zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz in Gebäuden eingesetzt werden. Du beschäftigst dich mit Themen wie Photovoltaik, intelligenten Haustechniksystemen und Elektromobilität, um komfortable und energieeffiziente Lösungen für Büros und Wohnräume zu schaffen.
Immer mehr Menschen wünschen sich Komfort in Büro und Zuhause, während sie Energie und Geld sparen sowie die Umwelt schützen. Da Strom wertvoller wird, müssen die täglichen Geräte effizienter und benutzerfreundlich sein. In diesem Kontext erlernst du Kenntnisse über elektrische Sicherheit, Elektromobilität, Energieverteilungsanlagen, Beleuchtungs- und Antriebssysteme sowie Blitzschutzanlagen.
Durch deine Kenntnisse in der Installation von Wärmepumpen, elektrischen Heizungssystemen und Batteriespeichertechnik trägst du zu einem sparsamen und sicheren Betrieb bei und unterstützt die Nutzung erneuerbarer Energien.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu zweieinhalb Jahre verkürzt werden.
Ausbildungsinhalte
Systeme der Energie- und Gebäudetechnik
Installation und Konfiguration von Gebäudesystemtechnik
Energieversorgungsanlagen
Empfangs- und Breitbandkommunikationsanlagen
u.a.
Unterricht
Der Unterricht wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 13 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den drei Bündelungsfächern „Installation und Inbetriebnahme elektrotechnischer Anlagen“, „Planung, Errichtung und Wartung gebäudetechnischer Systeme“, „Planung, Errichtung und Wartung energietechnischer Anlagen“ organisiert.
Lernfelder:
Elektrotechnische Systeme analysieren, Funktionen prüfen und Fehler beheben
Elektrische Systeme planen und installieren
Steuerungen und Regelungen analysieren und realisieren
Informationstechnische Systeme bereitstellen
Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Anlagen und Geräten konzipieren
Elektrotechnische Systeme analysieren und prüfen
Steuerungen und Regelungen für Systeme programmieren und realisieren
Energiewandlungssysteme auswählen und integrieren
Kommunikation von Systemen in Wohn- und Zweckbauten planen und realisieren
Elektrische Geräte und Anlagen der Haustechnik planen, in Betrieb nehmen und übergeben
Energietechnische Systeme errichten, in Betrieb nehmen und instand halten
Energie- und gebäudetechnische Anlagen planen und realisieren
Energie- und gebäudetechnische Systeme anpassen und dokumentieren
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in mit großen Praxisbezug auch in speziellen Fachräumen statt. Dabei kommen u.a.
Prüfen und Messen nach DIN VDE 0600-100 und 0701-0702,
Programmierung speicherprogrammierbarer Kleinsteuerungen mit Siemens Logo,
CAD-Schaltungsentwurf mit SeeElectrical und
Übungsboard für KNX-Gebäudeautomation
zum Einsatz.
Karrierechancen
Meister
Studium
Selbstständigkeit
Mögliche Arbeitsbereiche
Betriebe der E-Handwerke
Immobilienwirtschaft
Technische Gebäudeausrüster
Kommunale Betriebsstätten
Betriebe für Beleuchtungs- und Signalanlagen
Ansprechpartner
Jens Fischer
Telefon: 02381/97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
Autor: Anja Fretter, ESB
Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung
Berufsbild
Fachinformatiker/innen für Anwendungsentwicklung sind planen, entwickeln und testen zuständig Softwarelösungen für den eigenen Betrieb oder für Kunden. Sie analysieren Anforderungen, konzipieren Programme und setzen diese mithilfe moderner Programmier-sprachen um. Zu ihren Aufgaben gehören beispielsweise die Erweiterung betriebseigener Programme oder die Entwicklung von neuen Lösungen, die auf die eigenen betrieblichen Bedürfnisse bzw. die Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Weiterhin die Installation und Inbetriebnahme von Softwareanwendungen und ggf. die Einweisung der Anwender. Auch die regelmäßige Aktualisierung und Wartung können zu ihrem Aufgabengebiet gehören.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu 2 Jahre verkürzt werden.
Ausbildungsinhalte
- Betriebswirtschaft und Arbeitsorganisation
- Programmierung
- Inbetriebnahme und Administration von IT-Systemen
- IT-Markt und Kundenorientierung
- Service und Support von IT-Systemen
- Konzeption von IT-Systemen
Unterricht
Der Unterricht wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 12 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den drei Bündelungsfächern Gestaltung von IT-Dienstleistungen, Entwicklung vernetzter Prozesse und Softwaretechnologie und Datenmanagement
organisiert.
Lernfelder:
- Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben
- Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten
- Clients in Netzwerke einbinden
- Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen
- Software zur Verwaltung von Daten anpassen
- Serviceanfragen bearbeiten
- Cyber-physische Systeme ergänzen
- Daten systemübergreifend bereitstellen
- Netzwerke und Dienste bereitstellen
- Benutzerschnittstellen gestalten und entwickeln
- Funktionalität in Anwendungen realisieren
- Kundenspezifische Anwendungsentwicklung durchführen
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt. Dabei kommen u.a.
- Servervirtualisierung mit Hyper-V
- Netzwerk- und IoT-Simulation (Cisco Packet Tracer) und
- Entwicklung von cyberphysischen Systemen mit dem Raspberry PI
zum Einsatz.
Ansprechpartnerin
Anja Fretter
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
- Beschreibung des Berufs (Bundesagentur für Arbeit)
- Bildungsplan (QUA-LiS)
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
Autor: Anja Fretter, ESB
Fachinformatiker*in Systemintegration
Berufsbild
Fachinformatiker/-innen der Fachrichtung Systemintegration sind für die Planung, Installation und Verwaltung von IT-Systemen verantwortlich. Sie agieren als Dienstleister sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei Kunden und beraten bei der Auswahl und Integration von Hard- und Softwarekomponenten. Sie planen, realisieren und betreuen komplexe vernetzte IT-Systeme inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten und schulen Anwender im Umgang mit den IT-Lösungen. Im laufenden Betrieb kümmern sie sich um die Wartung und Pflege sowie um die Anpassung der Systeme an neue Anforderungen.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu 2 Jahre verkürzt werden.
Ausbildungsinhalte
- Hardwarekomponenten von Arbeitsplatz- und Serversystemen
- Netzwerktechnik
- Grundlagen der Softwareentwicklung
- IT-Sicherheit
- Grundlagen Internet of things
- Wirtschafts- und Betriebslehre
Unterricht
Der Unterricht wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 12 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den drei Bündelungsfächern Gestaltung von IT-Dienstleistungen, Entwicklung vernetzter Prozesse und Softwaretechnologie und Datenmanagement
organisiert.
Lernfelder:
- Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben
- Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten
- Clients in Netzwerke einbinden
- Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen
- Software zur Verwaltung von Daten anpassen
- Serviceanfragen bearbeiten
- Cyber-physische Systeme ergänzen
- Daten systemübergreifend bereitstellen
- Netzwerke und Dienste bereitstellen
- Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren
- Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten
- Kundenspezifische Systemintegration durchführen
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt. Dabei kommen u.a.
- Servervirtualisierung mit Hyper-V
- Netzwerk- und IoT-Simulation (Cisco Packet Tracer) und
- Entwicklung von cyberphysischen Systemen mit dem Raspberry PI
zum Einsatz.
Ansprechpartnerin
Anja Fretter
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
- Beschreibung des Berufs (Bundesagentur für Arbeit)
- Bildungsplan (QUA-LiS)
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
Fachinformatiker*in – Digitale Vernetzung
Autor: Dr. Rainer Hohenburg
Industriemechaniker*in
Berufsbild
Industriemechaniker/innen sind für die Organisation und Kontrolle von Produktionsabläufe zuständig. Sie stellen sicher, dass Maschinen und Fertigungsanlagen betriebsbereit sind. Sie sind für die Errichtung von Maschinen und Fertigungsanlagen zuständig und auch für deren Installation, Vernetzung und deren Inbetriebnahme. Mit dem Schwerpunkt der Produktionstechnik, sind sie für das Einrichten von Maschinen, deren Umbau und deren Fertigung zuständig. Die Betriebsanlagen werden ebenso von ihnen gewartet und repariert. Dazu zählt die Wahl von Prüfmitteln, die Feststellung von Störungsursachen und deren Tausch. Ebenso werden von ihnen Ersatzteile mithilfe von CNC-Maschinen hergestellt. Im letzten Schritt erfolgt die Übergabe der Produkte und technischer Anlagen an die Kunden und die entsprechende Einweisung.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu zweieinhalb Jahre verkürzt werden.
Die Ausbildung im Überblick
Ausbildungsinhalte
- Beurteilung und Auswahl von Werkstoffe nach ihrer Verwendung
- Herstellung von Werkstücken und Bauteilen, sowie die Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen sicherzustellen
Nutzung und Anwendung von Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visualisierungssystemen - Inspektion, Wartung und Pflege von Betriebsmitteln
- Auswertung von steuerungstechnischen Unterlagen
- Anwendung von Steuerungstechnik
- Herstellung und Anpassung von Bauteile durch Kombination verschiedener Fertigungsverfahren
- Sicherstellen der Funktionsfähigkeit von Maschinen und Systemen durch Steuern, Regeln und Überwachen der Arbeitsbewegungen
- Wartung, Inspektion und Instandsetzung von Maschinen und Systemen
- Installation und Prüfung von elektrischen Komponenten und Baugruppen mithilfe betriebliche Qualitätssicherungssysteme
Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über Themen wie Rechte und Pflichten während der Ausbildung, Organisation des Ausbildungsbetriebs und Umweltschutz vermittelt.
Unterricht
Der Unterricht wird im Blockunterricht an mehreren Tagen hintereinander jeweils in mehreren Wochenblöcken unterrichtet. Er besteht aus 15 praxisnahen Lernfeldern, die im Folgenden dargestellt sind:
Lernfelder:
1. Ausbildungsjahr
1. Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen
2. Fertigen von Bauelementen mit Maschinen
3. Herstellen von einfachen Baugruppen
4. Warten technischer Systeme
2. Ausbildungsjahr
5. Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen
6. Installieren und Inbetriebnehmen steuerungstechnischer Systeme
7. Montieren von technischen Teilsystemen
8. Fertigen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen
9. Instandsetzen von technischen Systemen
3. Ausbildungsjahr
10: Herstellen und Inbetriebnehmen von technischen Systemen
11: Überwachen der Produkt- und Prozessqualität
12: Instandhalten von technischen Systemen
13: Sicherstellen der Betriebsfähigkeit automatisierter Systeme
4. Ausbildungsjahr
14: Planen und Realisieren technischer Systeme
15: Optimieren von technischen Systemen
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt. Dabei kommen u.a.
- CAD-Anwendungen (Inventor)
- Pneumatik- und Elektropneumatik- Anwendungen (Festo, Siemens-Komponenten) und
- CNC-Anwendungen (DMG MORI - Bearbeitungszentren)
zum Einsatz.
Ansprechpartner
Mathias Weikert
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/29055
- Bildungsplan (QUA-LiS)
https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsgaenge-bildungsplaene/fachklassen-duales-system-anlage-a/berufe-a-bis-z/industriemechanik/ein-industriemechaniker.html
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/a-z/ausbildungsberufe-i/industriemechaniker-in
Autor: Schiller, ESB
Maler*in und Lackierer*in
Berufsbild
Maler/innen und Lackierer/innen der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung gestalten und behandeln Innenwände, Decken, Böden und Fassaden von Gebäuden sowie die Oberflächen von Objekten aus verschiedenen Materialien. Sie sind im Neubau, bei der Sanierung und Modernisierung tätig. Bevor sie Flächen beschichten, bereiten sie die Untergründe vor und bessern Putzschäden an Wänden und Decken aus. Innenräume gestalten sie mit unterschiedlichen Maltechniken, aber auch mit Tapeten und Dekorputzen. Durch den Einbau von Dämmstoffen oder das Aufbringen von Wärmedämm-Verbundsystemen leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung. Holz und Holzwerkstoffe, z.B. Fenster, Türen und Zäune, schützen sie mit geeigneten Lasuren, Farben oder Lacken. Gegebenenfalls entwerfen und fertigen sie z.B. Schriften und Logos für Hinweisschilder und andere Werbemittel.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildung dauert drei Jahre; eine vorzeitige Zulassung zur Prüfung nach 2,5 Jahren oder eine Verkürzung auf zwei Jahre ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Ausbildungsinhalte
Ausbildungsinhalte sind u.a.:
- Entwerfen und Umsetzen von Konzepten für die Raum- und Fassadengestaltung
- Gestalten von Oberflächen mit Mustern, mit durch Werkzeuge oder Geräte hergestellten Strukturen (Werkzeugstrukturen) und Beschichtungsstoffen
- Verlegen von Wand-, Decken- und Bodenbelägen sowie Bekleiden von Decken und Wänden
- Herstellen von Beschriftungen und Kommunikationsmitteln
- Durchführen von Maßnahmen zum Holz- und Bautenschutz sowie zum Brandschutz
- Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen an Decken-, Wand- und Bodenflächen
- Herstellen, Bearbeiten, Beschichten, Bekleiden, Gestalten und Instandhalten von Oberflächen
- Durchführen von Putz-, Dämm- und Trockenbauarbeiten
Unterricht
Der Unterricht wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 12 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den drei Bündelungsfächern Beschichtung, Montage- und Instandsetzung und Gestaltung organisiert.
Lernfelder:
- Metallische Untergründe bearbeiten
- Nichtmetallische Untergründe bearbeiten
- Oberflächen und Objekte herstellen
- Oberflächen gestalten
- Schutz- und Spezialbeschichtungen ausführen
- Instandhaltungsmaßnahmen ausführen
- Dämm-, Putz- und Montagearbeiten ausführen
- Oberflächen und Objekte bearbeiten und gestalten
- Innenräume gestalten
- Fassaden gestalten
- Objekte in Stand setzen
Dekorative und kommunikative Gestaltungen ausführen
Die inhaltliche Bearbeitung der Lernfelder erfolgt in Lernsituationen. Anhand von zunehmend komplexeren Themenstellungen werden alle Lerninhalte, im Sinne der Bildungspläne, erarbeitet. Die Lernsituationen sind so gestaltet, dass ein Bezug zur Arbeitswirklichkeit besteht und das selbstständige Lernen gefördert wird.
In Kundenaufträgen werden Farbkonzepte erarbeitet, Arbeitsabläufe geplant und Flächen sowie Materialmengen für eine Kalkulation berechnet.
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Betriebskalkulation, Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht wird durch praktische Übungen wie die Erstellung von dekorativen Sondertechniken (z.B. Spachteltechniken u. Lasurtechniken) ergänzt. Farbentwürfe werden u.a. am PC erstellt und Lackierungen im Spritzverfahren in der Lackierkabine erprobt.
Besonderheiten/ Aktivitäten
Im Rahmen der Lernsituationen werden u.a. Exkursionen (Zukunftstag des Landesinnungsverbandes Westfalen) und Messebesuche zur Fachmesse Farbe, Ausbau & Fassade nach Köln durchgeführt.
Ansprechpartner
Stefan Meier- von Broich
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
Autor: Frank Lange
Metallbauer/in – Fachrichtung Konstruktionstechnik
Tätigkeitsbeschreibung:
Metallbauerinnen und Metallbauer der Fachrichtung Konstruktionstechnik fertigen und montieren Stahl- und Metallkonstruktionen wie Treppen, Geländer, Überdachungen, Tore oder ganze Hallen. Sie bearbeiten Metalle durch Schweißen, Nieten, Schrauben und Biegen, stellen Baugruppen her und montieren sie vor Ort. Dabei arbeiten sie nach technischen Zeichnungen und unter Berücksichtigung von Sicherheitsvorschriften. Auch die Wartung und Instandhaltung bestehender Konstruktionen gehört zu ihrem Aufgabenfeld.
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (duale Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule)
Einsatzorte: Werkstätten, Fertigungshallen, Baustellen – häufig im Team und oft im Freien
Perspektiven:
Nach der Ausbildung sind Spezialisierungen oder Weiterbildungen zum/zur Techniker/in, Meister/in oder sogar ein Studium im Bereich Maschinenbau oder Konstruktionstechnik möglich.
Anforderungen:
- Handwerkliches Geschick und gute Auge-Hand-Koordination
z. B. beim Verschrauben und Nieten von Metallbauteilen oder Setzen von Schweißpunkten - Sorgfalt
z. B. beim präzisen Einpassen von Scharnieren, Schlössern und elektrischen Antrieben - Technisches Verständnis
z. B. beim Einrichten, Bedienen und Warten technischer Systeme und Maschinen - Räumliches Vorstellungsvermögen
z. B. beim Umsetzen technischer Zeichnungen in reale Konstruktionen - Gute körperliche Konstitution und Schwindelfreiheit
z. B. beim Heben schwerer Bauteile oder Arbeiten auf Gerüsten und Arbeitsbühnen
Wichtige Schulfächer:
- Werken/Technik
z. B. für den Umgang mit Arbeitsplänen und das Umsetzen technischer Zeichnungen - Mathematik
z. B. für das Berechnen von Flächen, Volumen, Massen und Materialbedarf - Physik
z. B. beim Verständnis von Kräften, Statik oder beim Aufbau einfacher Steuerungen und Schaltpläne
Weiterführende Informationen: https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/2277
Ansprechpartnerin
Dieter Wettendorf
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Autor: Schiller, ESB
Tischler*in
Berufsbild
Tischler*innen bauen Schränke, Sitzmöbel, Tische, Fenster und Türen, aber sie stellen auch Innenausbauten und Ladeneinrichtungen her. Sie beraten ihre Kunden anhand selbstgefertigter Skizzen und entwickeln Konstruktionen zunächst am Computer per CAD-Technik. Nach Auftragseingang be- und verarbeiten sie Holz und Holzwerkstoffe mit einer Vielzahl unterschiedlicher, auch computergesteuerter Technologien. Tischler/innen sägen, hobeln und schleifen, verarbeiten Furniere und behandeln die Holzoberflächen ihrer Produkte, bevor sie zusammengebaut werden.
Auf Baustellen montieren sie Fenster, Treppen und Türen; in Wohn- oder Büroräumen verlegen sie Parkettböden und montieren Einbauschränke, Raumteiler oder Wand- u. Deckenverkleidungen. Der Beruf des Tischlers/ der Tischlerin ist ein anerkannter Ausbildungsberuf im Handwerk.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildung dauert drei Jahre; eine vorzeitige Zulassung zur Prüfung nach 2,5 Jahren oder eine Verkürzung auf zwei Jahre ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Am Ende der Ausbildung muss ein individuelles Gesellenstück konstruiert und gefertigt werden.
Ausbildungsinhalte
Ausbildungsinhalte sind u.a.:
- Be- und Verarbeitung von Holz, Holzwerkstoffen und sonstigen Werkstoffen
- Gestaltung, Konstruktion und Planung von Möbeln, Bauelementen u. Innenausbauten
- Einrichtung, Bedienung und Instandhaltung von Werkzeugen, Geräten und Maschinen
- Behandlung und Veredelung von Oberflächen
- Durchführung von Montage- und Demontagearbeiten
Umgang mit CAD-Technik und computergesteuerten Maschinen (CNC-Technik)
Unterricht
Der Unterricht wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 12 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den drei Bündelungsfächern Entwicklungs- und Planungsprozesse, Fertigungsprozesse und Montage/ Service organisiert.
Lernfelder:
- Einfache Produkte aus Holz herstellen
- Zusammengesetzte Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen herstellen
- Produkte aus unterschiedlichen Werkstoffen herstellen
- Kleinmöbel herstellen
- Einzelmöbel herstellen
- Systemmöbel herstellen
- Einbaumöbel herstellen und montieren
- Raumbegrenzende Elemente des Innenausbaus herstellen und montieren
- Bauelemente des Innenausbaus herstellen und montieren
- Baukörper abschließende Bauelemente herstellen und montieren
- Erzeugnisse warten und instand halten
- Einen Arbeitsauftrag aus dem Tätigkeitsfeld ausführen
Die inhaltliche Bearbeitung der Lernfelder erfolgt in Lernsituationen. Anhand von zunehmend komplexeren Themenstellungen werden alle Lerninhalte, im Sinne der Bildungspläne, erarbeitet. Die Lernsituationen sind so gestaltet, dass ein großer Praxisbezug besteht und das selbstständige Lernen gefördert wird.
In der Mittelstufe wird im Rahmen des Lernfeldes Möbelbau das Projekt „Mini-Gesellenstück“ in Theorie und Praxis durchgeführt, bei dem ein individuelles Möbelstück geplant und in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben gefertigt wird.
Der Fachunterricht findet u.a. in der Holzwerkstatt mit CNC-Bearbeitungszentrum und in PC-Räumen statt, um einen möglichst großen Praxisbezug herzustellen. Dabei werden auch neue Technologien, wie z.B. CAD-Technik mit Vectorworks, CNC-Technik mit Woodwop und digitale Bearbeitung mit der Shaper Origin angewendet.
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Besonderheiten/ Aktivitäten
Im Rahmen der Lernsituationen werden u.a. Exkursionen und Betriebsbesichtigungen sowie Messebesuche, z.B. zur Möbelmesse oder zur LIGNA, durchgeführt. Zudem findet jeweils zu Beginn des dritten Lehrjahres eine mehrtägige Klassenfahrt nach Hamburg statt, wo der weltbekannte Flügelhersteller Steinway&Sons, der Flugzeugbauer Airbus und die Edelholzhandlung Cropp feste Programmpunkte sind.
Ansprechpartner
Hans Schiller
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
- Beschreibung des Berufs (Bundesagentur für Arbeit)
- Bildungsplan (QUA-LiS)
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
- born2btischler
Ausbildungsprofil (DAS HANDWERK)
Autor: Dr. Rainer Hohenburg, ESB
Kraftfahrzeugmechatronik
Berufsbild
Bei dem Beruf Kraftfahrzeugmechatronikerin/Kraftfahrzeugmechatroniker handelt es sich um einen handwerklichen Beruf, indem mechanische, elektronische, pneumatische, hydraulische und informationstechnische Aufgaben im Rahmen der Fahrzeugtechnik integriert sind.
Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und Kraftfahrzeugmechatroniker sind für Servicetätigkeiten, Diagnose bei fehlerhaften Systemen, Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen mit unterschiedlichsten Antriebskonzepten zuständig. Zudem übernehmen sie Um- und Nachrüstarbeiten an Fahrzeugsystemen, die in das vorhandene System integriert werden müssen. Dabei beraten Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und -mechatroniker die Kunden und informieren diese über durchgeführte arbeiten.
Typische Aufgaben, die auf das Berufsbild zutreffen sind:
Analyse von Fahrzeugkomponenten mithilfe elektronischer und computergestützter Systeme
Prüfung und Austausch von Bauteilen
Reparatur von elektrischen (hoch- und Niedervoltbauteilen), pneumatischen, mechanischen und hydraulischen Fahrzeugkomponenten
Service von Fahrzeugen, wie das Wechseln von Schmier- oder weiteren Betriebsstoffen
Überprüfen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Systemen
Ausbildungsdauer und -organisation
Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre und kann unter bestimmten Voraus-setzungen auf bis zu zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Absolviert wird die Ausbildung durch eine gestreckte Gesellenprüfung, die sich aus einer theoretischen und praktischen Prüfung nach ca. zwei Jahren Ausbildung und einer theoretischen und praktischen Prüfung nach dreieinhalb Jahren zusammensetzt.
Angebotene Schwerpunkte:
Am Eduard-Spranger-Berufskolleg kann die Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin/ zum Kraftfahrzeugmechatroniker in folgenden Schwerpunkten erfolgen:
Personenkraftwagentechnik
Nutzfahrzeugtechnik
System- und Hochvolttechnik
Merkmale der Ausbildung und des Unterrichts
Die Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin/zum Kraftfahrzeugmechatroniker erfolgt nach dem dualen System. Dies bedeutet, dass der Ausbildungsbetrieb und die berufsbildende Schule für die Ausbildung verantwortlich sind. Der Unterricht am Eduard-Spranger-Berufskolleg wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 14 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den vier Bündelungsfächern „Service“, „Reparatur“, „Diagnose“, „Umrüsten und Nachrüsten“ organisiert. Alle Schwerpunkte werden bis zum dritten Lehrjahr in den folgenden zehn Lernfelderern unterrichtet.
- Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren
- Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren
- Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
- Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen
- Inspektionen und Zusatzarbeiten durchführen
- Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und beheben
- Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen
- Mechatronische Systeme des Antriebsmanagements diagnostizieren
- Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen
- Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen
Die letzten vier verbliebenden Lernfelder werden spezifisch je nach Schwerpunkt differenziert.
Für den Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Antriebskomponenten reparieren
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Für den Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Antriebskomponenten reparieren
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Für den Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Komponenten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen prüfen und instand setzen
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt sowie in unserer KFZ-Halle in der Lernfabrik „Industrie 4.0“. Besonders hervorzuheben sind folgende praktische Unterrichtselemente:
- Werkstattunterricht in unserer Metallwerkstatt, in der Grundlagen zur Metallverarbeitung vermittelt werden (Arbeiten mit Bohrmaschinen, Erstellen von Gewindereparaturen mit gängigen Werkzeugen und Materialien aus der Fahrzeugtechnik
- Werkstattunterricht in unserer Elektronikwerkstatt, in der Grundlagen zur Elektrotechnik vermittelt werden (Arbeiten mit Labornetzteilen, Multimetern)
- Reparaturen an Bremssystemen in unserer KFZ-Halle (Bremsleitungsbau und mechanische Messungen an Bremssystemen)
- Mechanische Vermessungen von Motoren in unserer KFZ-Halle (Zylinder- und Kolbenvermessungen)
- Fehlerdiagnose an zwei Schulungsfahrzeugen oder einem Demonstrationsmotor mithilfe gängiger Diagnosesysteme aus der Fahrzeugtechnik (Fehlerspeicherabfrage, Nutzung der verbauten Messelektronik, wie Multimeter, Hochvoltmodul oder Oszilloskope)
- Fehlerdiagnose an isolierten Fahrzeugsystemen (Schulungstafeln), um einzelne Systeme fassbar zu gestalten (Trainingssysteme zu Hochvoltbatterien, zum Freischalten von Hochvoltfahrzeugen, zu Sensoren, Aktoren oder grundlegender Elektrotechnik wie Beleuchtungsanlagen)
Voraussetzung für den Bildungsgang:
- Es muss ein Ausbildungsverhältnis mit einem Betrieb bestehen
- Technisches Verständnis
- Interesse an Elektrotechnik und Mechanik
- Handwerkliches Geschick
- Teamfähigkeit
Ansprechpartner
Patrick Kabik
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
- Beschreibung des Berufs (Bundesagentur für Arbeit)
- Bildungsplan (QUA-LiS)
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
Autor: Dr. Rainer Hohenburg, ESB
Kraftfahrzeugmechatronik
Berufsbild
Bei dem Beruf Kraftfahrzeugmechatronikerin/Kraftfahrzeugmechatroniker handelt es sich um einen handwerklichen Beruf, indem mechanische, elektronische, pneumatische, hydraulische und informationstechnische Aufgaben im Rahmen der Fahrzeugtechnik integriert sind.
Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und Kraftfahrzeugmechatroniker sind für Servicetätigkeiten, Diagnose bei fehlerhaften Systemen, Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen mit unterschiedlichsten Antriebskonzepten zuständig. Zudem übernehmen sie Um- und Nachrüstarbeiten an Fahrzeugsystemen, die in das vorhandene System integriert werden müssen. Dabei beraten Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und -mechatroniker die Kunden und informieren diese über durchgeführte arbeiten.
Typische Aufgaben, die auf das Berufsbild zutreffen sind:
Analyse von Fahrzeugkomponenten mithilfe elektronischer und computergestützter Systeme
Prüfung und Austausch von Bauteilen
Reparatur von elektrischen (hoch- und Niedervoltbauteilen), pneumatischen, mechanischen und hydraulischen Fahrzeugkomponenten
Service von Fahrzeugen, wie das Wechseln von Schmier- oder weiteren Betriebsstoffen
Überprüfen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Systemen
Ausbildungsdauer und -organisation
Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre und kann unter bestimmten Voraus-setzungen auf bis zu zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Absolviert wird die Ausbildung durch eine gestreckte Gesellenprüfung, die sich aus einer theoretischen und praktischen Prüfung nach ca. zwei Jahren Ausbildung und einer theoretischen und praktischen Prüfung nach dreieinhalb Jahren zusammensetzt.
Angebotene Schwerpunkte:
Am Eduard-Spranger-Berufskolleg kann die Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin/ zum Kraftfahrzeugmechatroniker in folgenden Schwerpunkten erfolgen:
Personenkraftwagentechnik
Nutzfahrzeugtechnik
System- und Hochvolttechnik
Merkmale der Ausbildung und des Unterrichts
Die Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin/zum Kraftfahrzeugmechatroniker erfolgt nach dem dualen System. Dies bedeutet, dass der Ausbildungsbetrieb und die berufsbildende Schule für die Ausbildung verantwortlich sind. Der Unterricht am Eduard-Spranger-Berufskolleg wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 14 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den vier Bündelungsfächern „Service“, „Reparatur“, „Diagnose“, „Umrüsten und Nachrüsten“ organisiert. Alle Schwerpunkte werden bis zum dritten Lehrjahr in den folgenden zehn Lernfelderern unterrichtet.
- Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren
- Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren
- Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
- Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen
- Inspektionen und Zusatzarbeiten durchführen
- Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und beheben
- Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen
- Mechatronische Systeme des Antriebsmanagements diagnostizieren
- Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen
- Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen
Die letzten vier verbliebenden Lernfelder werden spezifisch je nach Schwerpunkt differenziert.
Für den Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Antriebskomponenten reparieren
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Für den Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Antriebskomponenten reparieren
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Für den Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Komponenten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen prüfen und instand setzen
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt sowie in unserer KFZ-Halle in der Lernfabrik „Industrie 4.0“. Besonders hervorzuheben sind folgende praktische Unterrichtselemente:
- Werkstattunterricht in unserer Metallwerkstatt, in der Grundlagen zur Metallverarbeitung vermittelt werden (Arbeiten mit Bohrmaschinen, Erstellen von Gewindereparaturen mit gängigen Werkzeugen und Materialien aus der Fahrzeugtechnik
- Werkstattunterricht in unserer Elektronikwerkstatt, in der Grundlagen zur Elektrotechnik vermittelt werden (Arbeiten mit Labornetzteilen, Multimetern)
- Reparaturen an Bremssystemen in unserer KFZ-Halle (Bremsleitungsbau und mechanische Messungen an Bremssystemen)
- Mechanische Vermessungen von Motoren in unserer KFZ-Halle (Zylinder- und Kolbenvermessungen)
- Fehlerdiagnose an zwei Schulungsfahrzeugen oder einem Demonstrationsmotor mithilfe gängiger Diagnosesysteme aus der Fahrzeugtechnik (Fehlerspeicherabfrage, Nutzung der verbauten Messelektronik, wie Multimeter, Hochvoltmodul oder Oszilloskope)
- Fehlerdiagnose an isolierten Fahrzeugsystemen (Schulungstafeln), um einzelne Systeme fassbar zu gestalten (Trainingssysteme zu Hochvoltbatterien, zum Freischalten von Hochvoltfahrzeugen, zu Sensoren, Aktoren oder grundlegender Elektrotechnik wie Beleuchtungsanlagen)
Voraussetzung für den Bildungsgang:
- Es muss ein Ausbildungsverhältnis mit einem Betrieb bestehen
- Technisches Verständnis
- Interesse an Elektrotechnik und Mechanik
- Handwerkliches Geschick
- Teamfähigkeit
Ansprechpartner
Patrick Kabik
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
- Beschreibung des Berufs (Bundesagentur für Arbeit)
- Bildungsplan (QUA-LiS)
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
Autor: Dr. Rainer Hohenburg, ESB
Kraftfahrzeugmechatronik
Berufsbild
Bei dem Beruf Kraftfahrzeugmechatronikerin/Kraftfahrzeugmechatroniker handelt es sich um einen handwerklichen Beruf, indem mechanische, elektronische, pneumatische, hydraulische und informationstechnische Aufgaben im Rahmen der Fahrzeugtechnik integriert sind.
Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und Kraftfahrzeugmechatroniker sind für Servicetätigkeiten, Diagnose bei fehlerhaften Systemen, Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen mit unterschiedlichsten Antriebskonzepten zuständig. Zudem übernehmen sie Um- und Nachrüstarbeiten an Fahrzeugsystemen, die in das vorhandene System integriert werden müssen. Dabei beraten Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und -mechatroniker die Kunden und informieren diese über durchgeführte arbeiten.
Typische Aufgaben, die auf das Berufsbild zutreffen sind:
Analyse von Fahrzeugkomponenten mithilfe elektronischer und computergestützter Systeme
Prüfung und Austausch von Bauteilen
Reparatur von elektrischen (hoch- und Niedervoltbauteilen), pneumatischen, mechanischen und hydraulischen Fahrzeugkomponenten
Service von Fahrzeugen, wie das Wechseln von Schmier- oder weiteren Betriebsstoffen
Überprüfen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Systemen
Ausbildungsdauer und -organisation
Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre und kann unter bestimmten Voraus-setzungen auf bis zu zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Absolviert wird die Ausbildung durch eine gestreckte Gesellenprüfung, die sich aus einer theoretischen und praktischen Prüfung nach ca. zwei Jahren Ausbildung und einer theoretischen und praktischen Prüfung nach dreieinhalb Jahren zusammensetzt.
Angebotene Schwerpunkte:
Am Eduard-Spranger-Berufskolleg kann die Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin/ zum Kraftfahrzeugmechatroniker in folgenden Schwerpunkten erfolgen:
Personenkraftwagentechnik
Nutzfahrzeugtechnik
System- und Hochvolttechnik
Merkmale der Ausbildung und des Unterrichts
Die Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin/zum Kraftfahrzeugmechatroniker erfolgt nach dem dualen System. Dies bedeutet, dass der Ausbildungsbetrieb und die berufsbildende Schule für die Ausbildung verantwortlich sind. Der Unterricht am Eduard-Spranger-Berufskolleg wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 14 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den vier Bündelungsfächern „Service“, „Reparatur“, „Diagnose“, „Umrüsten und Nachrüsten“ organisiert. Alle Schwerpunkte werden bis zum dritten Lehrjahr in den folgenden zehn Lernfelderern unterrichtet.
- Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren
- Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren
- Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
- Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen
- Inspektionen und Zusatzarbeiten durchführen
- Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und beheben
- Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen
- Mechatronische Systeme des Antriebsmanagements diagnostizieren
- Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen
- Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen
Die letzten vier verbliebenden Lernfelder werden spezifisch je nach Schwerpunkt differenziert.
Für den Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Antriebskomponenten reparieren
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Für den Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Antriebskomponenten reparieren
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Für den Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Komponenten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen prüfen und instand setzen
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt sowie in unserer KFZ-Halle in der Lernfabrik „Industrie 4.0“. Besonders hervorzuheben sind folgende praktische Unterrichtselemente:
- Werkstattunterricht in unserer Metallwerkstatt, in der Grundlagen zur Metallverarbeitung vermittelt werden (Arbeiten mit Bohrmaschinen, Erstellen von Gewindereparaturen mit gängigen Werkzeugen und Materialien aus der Fahrzeugtechnik
- Werkstattunterricht in unserer Elektronikwerkstatt, in der Grundlagen zur Elektrotechnik vermittelt werden (Arbeiten mit Labornetzteilen, Multimetern)
- Reparaturen an Bremssystemen in unserer KFZ-Halle (Bremsleitungsbau und mechanische Messungen an Bremssystemen)
- Mechanische Vermessungen von Motoren in unserer KFZ-Halle (Zylinder- und Kolbenvermessungen)
- Fehlerdiagnose an zwei Schulungsfahrzeugen oder einem Demonstrationsmotor mithilfe gängiger Diagnosesysteme aus der Fahrzeugtechnik (Fehlerspeicherabfrage, Nutzung der verbauten Messelektronik, wie Multimeter, Hochvoltmodul oder Oszilloskope)
- Fehlerdiagnose an isolierten Fahrzeugsystemen (Schulungstafeln), um einzelne Systeme fassbar zu gestalten (Trainingssysteme zu Hochvoltbatterien, zum Freischalten von Hochvoltfahrzeugen, zu Sensoren, Aktoren oder grundlegender Elektrotechnik wie Beleuchtungsanlagen)
Voraussetzung für den Bildungsgang:
- Es muss ein Ausbildungsverhältnis mit einem Betrieb bestehen
- Technisches Verständnis
- Interesse an Elektrotechnik und Mechanik
- Handwerkliches Geschick
- Teamfähigkeit
Ansprechpartner
Patrick Kabik
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
- Beschreibung des Berufs (Bundesagentur für Arbeit)
- Bildungsplan (QUA-LiS)
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
Autor: Dr. Rainer Hohenburg, ESB
Kraftfahrzeugmechatronik
Berufsbild
Bei dem Beruf Kraftfahrzeugmechatronikerin/Kraftfahrzeugmechatroniker handelt es sich um einen handwerklichen Beruf, indem mechanische, elektronische, pneumatische, hydraulische und informationstechnische Aufgaben im Rahmen der Fahrzeugtechnik integriert sind.
Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und Kraftfahrzeugmechatroniker sind für Servicetätigkeiten, Diagnose bei fehlerhaften Systemen, Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen mit unterschiedlichsten Antriebskonzepten zuständig. Zudem übernehmen sie Um- und Nachrüstarbeiten an Fahrzeugsystemen, die in das vorhandene System integriert werden müssen. Dabei beraten Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und -mechatroniker die Kunden und informieren diese über durchgeführte arbeiten.
Typische Aufgaben, die auf das Berufsbild zutreffen sind:
Analyse von Fahrzeugkomponenten mithilfe elektronischer und computergestützter Systeme
Prüfung und Austausch von Bauteilen
Reparatur von elektrischen (hoch- und Niedervoltbauteilen), pneumatischen, mechanischen und hydraulischen Fahrzeugkomponenten
Service von Fahrzeugen, wie das Wechseln von Schmier- oder weiteren Betriebsstoffen
Überprüfen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Systemen
Ausbildungsdauer und -organisation
Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre und kann unter bestimmten Voraus-setzungen auf bis zu zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Absolviert wird die Ausbildung durch eine gestreckte Gesellenprüfung, die sich aus einer theoretischen und praktischen Prüfung nach ca. zwei Jahren Ausbildung und einer theoretischen und praktischen Prüfung nach dreieinhalb Jahren zusammensetzt.
Angebotene Schwerpunkte:
Am Eduard-Spranger-Berufskolleg kann die Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin/ zum Kraftfahrzeugmechatroniker in folgenden Schwerpunkten erfolgen:
Personenkraftwagentechnik
Nutzfahrzeugtechnik
System- und Hochvolttechnik
Merkmale der Ausbildung und des Unterrichts
Die Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin/zum Kraftfahrzeugmechatroniker erfolgt nach dem dualen System. Dies bedeutet, dass der Ausbildungsbetrieb und die berufsbildende Schule für die Ausbildung verantwortlich sind. Der Unterricht am Eduard-Spranger-Berufskolleg wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 14 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den vier Bündelungsfächern „Service“, „Reparatur“, „Diagnose“, „Umrüsten und Nachrüsten“ organisiert. Alle Schwerpunkte werden bis zum dritten Lehrjahr in den folgenden zehn Lernfelderern unterrichtet.
- Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren
- Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren
- Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen
- Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen
- Inspektionen und Zusatzarbeiten durchführen
- Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und beheben
- Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen
- Mechatronische Systeme des Antriebsmanagements diagnostizieren
- Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen
- Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen
Die letzten vier verbliebenden Lernfelder werden spezifisch je nach Schwerpunkt differenziert.
Für den Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Antriebskomponenten reparieren
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Für den Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Antriebskomponenten reparieren
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Für den Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik sind es die Lernfelder:
- Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen
- Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten
- Komponenten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen prüfen und instand setzen
- Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt sowie in unserer KFZ-Halle in der Lernfabrik „Industrie 4.0“. Besonders hervorzuheben sind folgende praktische Unterrichtselemente:
- Werkstattunterricht in unserer Metallwerkstatt, in der Grundlagen zur Metallverarbeitung vermittelt werden (Arbeiten mit Bohrmaschinen, Erstellen von Gewindereparaturen mit gängigen Werkzeugen und Materialien aus der Fahrzeugtechnik
- Werkstattunterricht in unserer Elektronikwerkstatt, in der Grundlagen zur Elektrotechnik vermittelt werden (Arbeiten mit Labornetzteilen, Multimetern)
- Reparaturen an Bremssystemen in unserer KFZ-Halle (Bremsleitungsbau und mechanische Messungen an Bremssystemen)
- Mechanische Vermessungen von Motoren in unserer KFZ-Halle (Zylinder- und Kolbenvermessungen)
- Fehlerdiagnose an zwei Schulungsfahrzeugen oder einem Demonstrationsmotor mithilfe gängiger Diagnosesysteme aus der Fahrzeugtechnik (Fehlerspeicherabfrage, Nutzung der verbauten Messelektronik, wie Multimeter, Hochvoltmodul oder Oszilloskope)
- Fehlerdiagnose an isolierten Fahrzeugsystemen (Schulungstafeln), um einzelne Systeme fassbar zu gestalten (Trainingssysteme zu Hochvoltbatterien, zum Freischalten von Hochvoltfahrzeugen, zu Sensoren, Aktoren oder grundlegender Elektrotechnik wie Beleuchtungsanlagen)
Voraussetzung für den Bildungsgang:
- Es muss ein Ausbildungsverhältnis mit einem Betrieb bestehen
- Technisches Verständnis
- Interesse an Elektrotechnik und Mechanik
- Handwerkliches Geschick
- Teamfähigkeit
Ansprechpartner
Patrick Kabik
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
- Beschreibung des Berufs (Bundesagentur für Arbeit)
- Bildungsplan (QUA-LiS)
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
Autor: Dr. Rainer Hohenburg, ESB
Maschinen- und Anlagenführer/innen
Berufsbild
Maschinen- und Anlagenführer/innen mit dem Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik sind für die Arbeiten an Maschinen und Anlagen zuständig. Ebenso befassen sie sich mit der Herstellung von Bauteilen, Baugruppen und Produkten aus Metall und Kunststoff. Bevor mit der Produktion begonnen wird, werden die Auftragsunterlagen gesichtet und die erforderlichen Materialien bereitgestellt. Danach erfolgt die Einrichtung von Anlagen wie Dreh-, Bohr-, Schleif-, Säge- oder Umformmaschinen. Diese werden von ihnen beschickt, in Betrieb genommen und bedient. Sie überwachen die Produktionsprozesse einschließlich der Qualität und Verpackung der fertigen Produkte. Korrekturen bei Abweichungen in der Qualität oder bei Störungen im Prozessablauf werden durchgeführt. Zudem ist die Wartung von Maschinen eine wichtige Aufgabe. Sie sind zuständig für den Tausch von Verschleißteile wie Dichtungen, Filter oder Schläuche oder auch das Füllen und Kontrollieren von Ölen oder Kühl- und Schmierstoffe.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel zwei Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt werden.
Die Ausbildung im Überblick
Ausbildungsinhalte
- Kontrolle und Wartung von Werkzeuge, Maschinen und Anlagen
- Kenntnisse und Anwendung von manuellen und maschinellen Fertigungstechniken
- Planung von Arbeitsabläufen und deren Abstimmung mit anderen Bereichen
- Kenntnisse über die Bereitstellung und Herstellung von Bauteilen, die durch Fügen, Spanen und Umformen, hergestellt werden und was bei der Montage und Demontage von Baugruppen zu beachten ist
- Auswahl von Werkzeugen für die jeweiligen Bearbeitungsverfahren und Ermittlung der passenden Technologiedaten
- Bedienung von Steuerungs- und Regelungseinrichtungen an Maschinen und Anlagen
- Rüstung und Umrüstung von Produktionsmaschinen und –anlagen sowie deren Inbetriebnahme
- Feststellung und Beseitigung von Störungen und Abweichungen im Produktionsprozess
- Überwachung und Sicherstellung des Materialflusses im Betrieb
Unterricht
Der Unterricht wird im Blockunterricht an mehreren Tagen hintereinander jeweils in mehreren Wochenblöcken unterrichtet. Er besteht aus 8 praxisnahen Lernfeldern, die jeweils mit 4 Lernfeldern in jedem Ausbildungsjahr aufgeteilt sind. Ein eigener Rahmenlehrplan bzw. Bildungsplan für Nordrhein-Westfalen liegt für diesen Ausbildungsberuf nicht vor. Die Beschulung der Auszubildenden richtet sich nach den Vorgaben der Bildungspläne für die ersten beiden Ausbildungsjahre je nach Schwerpunkt des Ausbildungsberufs.
Die Lernfelder eins bis vier im ersten Ausbildungsjahr entsprechen den Lernfeldern eins bis vier der Rahmenlehrpläne für die handwerklichen und industriellen Metallberufe. Zur Übersicht sind die weiteren Lernfelder für die Fachrichtung Montagetechnik im zweiten Ausbildungsjahr dargestellt. .
Lernfelder:
1. Ausbildungsjahr
1. Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen
2. Bauelemente mit Maschinen fertigen
3. Baugruppen herstellen und montieren
4. Technische Systeme instand halten
2. Ausbildungsjahr Fachrichtung Montagetechnik
5. Baugruppen herstellen
6. Bauelemente und Baugruppen montieren und demontieren
7. Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen, bedienen und überwachen
8. Betriebsbereitschaft von Maschinen und Anlagen gewährleisten
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt. Dabei kommen u.a.
- CAD-Anwendungen (Inventor) und
Pneumatik- und Elektropneumatik- Anwendungen (Festo, Siemens-Komponenten)
zum Einsatz.
Ansprechpartner
Sebastian Mahnke
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
- Beschreibung des Berufs (Bundesagentur für Arbeit)
- Bildungsplan (QUA-LIS)
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
Autor: Dr. Rainer Hohenburg
Fachkraft für Metalltechnik - Montagetechnik
Berufsbild
Fachkräfte für Metalltechnik der Fachrichtung Montagetechnik sind für die Fertigung von Verbindungen aus Einzelteilen Bauteile, Baugruppen und Maschinen zuständig.
Mit Beginn beschäftigen sie sich mit den Fertigungs- und Montageaufträgen und den passenden Arbeitsschritten. Anschließend erfolgt die Fertigung mithilfe von manuellen oder maschinellen Werkzeugen- und Werkzeugmaschinen und den passenden Fertigungseinrichtungen. Die Bauteile werden zu Baugruppen montiert. Verbindungstechniken, wie z.B. Schrauben, Stifte, Passungen, oder Schweißnähte kommen zum Einsatz.
Montagen an Leitungen als auch an elektronischen Elemente werden unter Beachtung deren Schalt- und Funktionspläne werden fachgerecht durchgeführt. Geräte, Maschinen oder Maschinenteile bestehen aus Bauelementen und Baugruppen. Die Fachkraft für Metalltechnik montiert die Bauteile lage- und funktionsgerecht unter Berücksichtigung der Teilefolge. Die Montageteile werden ausgerichtet, fixiert und gesichert. Zuletzt findet die Funktionseinstellung und deren Überprüfung statt.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel zwei Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt werden.
Die Ausbildung im Überblick
Ausbildungsinhalte
- Tätigkeiten mit technischen Geräten, sowie mit Maschinen und Anlagen (z.B. Hebeeinrichtungen, Messmittel und elektrische Prüfgeräte)
- Tätigkeiten mit handgeführten Maschinen und Werkzeugen (z.B. Fräsen, Feilen, Sägen oder Bohrern)
- Tätigkeiten im Gehen und Stehen
- Nutzung und Tragen von Schutzausrüstung und Schutzkleidung (z.B. Sicherheitshelme, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe und Sicherheitsbrillen)
- Arbeit in Werk- und Produktionshallen, sowie in Werkhallen bei Rauch, Staub, Gasen, Dämpfen
- Arbeit unter starker Lärmumgebung Und Unfallgefahr (z.B. Maschinenlärm in der Werkhalle, Verletzungsrisiko beim Umgang mit Hebezeugen))
- Heben und Tragen von schweren Maschinen und Bauteilen
- Arbeiten in Einzel-, Gruppen-, und Teamarbeit
Unterricht
Der Unterricht wird im Blockunterricht an mehreren Tagen hintereinander jeweils in mehreren Wochenblöcken unterrichtet. Er besteht aus 8 praxisnahen Lernfeldern, die jeweils mit 4 Lernfeldern in jedem Ausbildungsjahr aufgeteilt sind. Der Rahmenlehrplan bzw. Bildungsplan für Nordrhein-Westfalen legt die Ausbildungsinhalte konkret fest. Die Beschulung der Auszubildenden richtet sich nach den Vorgaben der Bildungspläne für die ersten beiden Ausbildungsjahre je nach Schwerpunkt des Ausbildungsberufs.
Die Lernfelder eins bis vier im ersten Ausbildungsjahr entsprechen genau den Lernfeldern eins bis vier der Rahmenlehrpläne für die handwerklichen und industriellen Metallberufe. Im zweiten Ausbildungsjahr werden weitere 4 Lernfelder für die Fachrichtung Montagetechnik abgedeckt.
Lernfelder:
1. Ausbildungsjahr
1. Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen
2. Bauelemente mit Maschinen fertigen
3. Baugruppen herstellen und montieren
4. Technische Systeme instand halten
2. Ausbildungsjahr Fachrichtung Montagetechnik
5. Baugruppen herstellen
6. Bauelemente und Baugruppen montieren und demontieren
7. Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen, bedienen und überwachen
8. Betriebsbereitschaft von Maschinen und Anlagen gewährleisten
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt. Dabei kommen u.a.
- CAD-Anwendungen (Inventor) und
Pneumatik- und Elektropneumatik- Anwendungen (Festo, Siemens-Komponenten)
zum Einsatz.
Ansprechpartner
Sebastian Mahnke
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
- Beschreibung des Berufs (Bundesagentur für Arbeit)
Fachkraft für Metalltechnik - Montagetechnik - BERUFENET - Bundesagentur für Arbeit - Bildungsplan (QUA-LIS)
Berufsbildung NRW - Bildungsgänge/Bildungspläne - Fachklassen duales System (Anlage A) - Berufe A bis Z - Fachkraft für Metalltechnik (2-jährig) - Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf)
Informationen zum Beruf: Fachkraft - Metalltechnik - planet-beruf.de
Autor: Dr. Rainer Hohenburg, ESB
Verfahrenstechnologe*in Metall – Stahlumformung
Berufsbild
Verfahrenstechnologen und -technologinnen Metall der Fachrichtung Stahlumformung sind für die Weiterverarbeitung und Formgebung von Stahlprodukten zuständig. Sie steuern einerseits die formändernden Umformprozesse und beschicken andererseits die Umformanlagen mit Vormaterialien wie Stahlrollen (so genannten ‚Coils’), Stabstahl, Draht oder auch Rohstahlblöcke und -barren.
In den Umformanlagen wird das Vormaterial durch verschiedene Umformprozesse wie Walzen, Ziehen, Biegen oder Pressen in die gewünschte Form gebracht. Dabei entstehen je nach Unternehmen Produkte wie spezielle Stahl- oder Aluminiumprofile für die Bauindustrie, Achsen, Federn oder andere Bauteile für die Automobilindustrie, Stahlrohre und –stäbe oder auch Bauteile für Maschinen und Anlagen wie Bolzen, Schrauben und Verbindungselemente.
Hierbei gilt es immer, die Gestaltänderung sorgfältig zu überwachen, die benötigten Kräfte zu regeln und auch die Produkte hinsichtlich der Kundenanforderungen zum Beispiel auf Gradheit und Oberflächengüte zu überprüfen.
Weil die Eigenschaften des Vormaterials einerseits innerhalb gewisser Toleranzen schwanken und andererseits die Abläufe in der Umformanlage Abnutzung und Verschleiß unterliegen ist es die Aufgabe von Verfahrenstechnologen und -technologinnen die daraus hervorgehenden Störeinflüsse zu kennen und diesen nachsteuernd durch Anpassung der Führungskräfte und – wege oder auch der Schmiermittelzufuhr entgegenzuwirken.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu zweieinhalb Jahre verkürzt werden.
Die Ausbildung im Überblick
Ausbildungsinhalte
- Bearbeitung von Werkstücken durch manuelle und maschinelle Fertigungsverfahren
- Fügen und Montieren von Bauteilen zu Baugruppen und deren Verbindungen z.B. durch Klemmen, Verschrauben, Kleben oder Verschweißen
- Ablesen von Messwerten, Beobachten von Signaleinrichtungen, und die Überwachung und Verstellung von Regelungs- und Steuerungskomponenten
- Montage- und Inbetriebnahme von pneumatischen, hydraulischen und elektrotechnischen Bauteilen
- Beschickung, Überwachung und Optimierung von Produktionsanlagen und Produktionsprozessen
- Inspektion und Wartung von Produktionssystemen und Anlagen
- Kenntnisse über Eisen- und Nichteisenmetalle, sowie deren Unterschiede hinsichtlich ihrer physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften
- Überwachen und Steuerung von Umformprozessen
- Entnahme von Proben und deren mechanisch-technologische Prüfungen
Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über Themen wie Rechte und Pflichten während der Ausbildung, Organisation des Ausbildungsbetriebs und Umweltschutz vermittelt.
Unterricht
Der Unterricht wird im Blockunterricht an mehreren Tagen hintereinander jeweils in mehreren Wochenblöcken unterrichtet. Er besteht aus 13 praxisnahen Lernfeldern, die im Folgenden dargestellt sind:
Lernfelder:
1. Ausbildungsjahr
1. Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen
2. Bauelemente mit Maschinen fertigen
3. Baugruppen herstellen und montieren
4. Technische Systeme instand halten
2. Ausbildungsjahr
5. Steuerungstechnische Systeme installieren und in Betrieb nehmen
6. Metallurgische Prozesse durchführen
7. Umformprozesse durchführen
8. Stoffe vor-, aufbereiten und lagern
3. Ausbildungsjahr
9a: Werkstoffe erzeugen
9b: Produkte durch Umformen herstellen
10: Werkstoffeigenschaften verändern
11: Produktionsanlagen instandhalten
4. Ausbildungsjahr
12: Produkte nach Kundenanforderung bereitstellen
13: Prozessqualität überwachen und optimieren
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt. Dabei kommen u.a.
- CAD-Anwendungen (Inventor) und
- Pneumatik- und Elektropneumatik- Anwendungen (Festo, Siemens-Komponenten)
- Werkstoffprüfeinrichtungen (Zugprüfmaschine, Kerbschlagbiegemaschine)
zum Einsatz.
Ansprechpartner
Andreas Strauch
Telefon: 02381 / 97306-0
E-Mail: wird verlinkt
Weiterführende Informationen
https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/130918
Bildungsplan (QUA-LiS) https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsgaenge-bildungsplaene/fachklassen-duales-system-anlage-a/berufe-a-bis-z/verfahrenstechnologen-metall/ein-verfahrenstechnolog-in-metall.html
- Einblicke in den Berufsalltag (planet-beruf) https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/a-z/ausbildungsberufe-v/verfahrenstechnologe-technologin-metall
Anlagenmechaniker*in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Autor: Lange, ESB
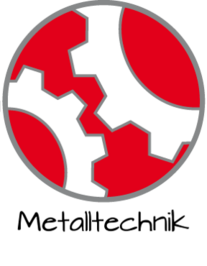
Tätigkeitsbeschreibung:
Anlagenmechanikerinnen und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik planen und installieren moderne Versorgungsanlagen in Gebäuden. Dazu gehören z. B. Wasserleitungen, Heizsysteme, Lüftungsanlagen oder umweltfreundliche Solartechnik. Sie richten Bäder ein, montieren Heizkörper, schließen Anlagen an und nehmen sie in Betrieb. Auch Wartung, Reparatur und Energieoptimierung bestehender Systeme gehören zu ihren Aufgaben.
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (duale Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule)
Einsatzorte: Baustellen, Wohnungen, Gewerbeobjekte, Technikräume – oft im direkten Kundenkontakt
Perspektiven:
Nach der Ausbildung bestehen viele Weiterbildungsoptionen, z. B. zum/zur Techniker/in, Meister/in oder in Richtung Energieberatung, Gebäudeautomatisierung oder ein Studium im Bereich Gebäudetechnik.
Anforderungen:
- Handwerkliches Geschick und Auge-Hand-Koordination
z. B. beim Verlegen und Verschweißen von Rohrleitungen oder Einbauen von Armaturen - Sorgfalt
z. B. beim Abdichten von Leitungen oder Justieren empfindlicher Mess- und Regeltechnik - Technisches Verständnis
z. B. für das Funktionsprinzip von Heizungs- und Klimaanlagen oder beim Anschließen elektrischer Komponenten - Räumliches Vorstellungsvermögen
z. B. beim Verlegen komplexer Leitungssysteme anhand von Plänen - Gute körperliche Konstitution
z. B. beim Arbeiten in beengten Räumen, auf Leitern oder mit schweren Geräten
Wichtige Schulfächer:
- Werken/Technik
z. B. für das Montieren von Bauteilen und Umsetzen von Installationsplänen - Mathematik
z. B. zum Berechnen von Rohrlängen, Wasserdruck, Heizlast oder Materialbedarf - Physik
z. B. beim Verständnis von Thermodynamik, Wasser- und Luftströmung, Energieumwandlung
Bauzeichner*in (Schwerpunkte: Architektur, Ingenieurbau, Tief-, Straßen- und Landschaftsbau)
Autor: Schiller, ESB

Berufsbild
Bauzeichner bzw. Bauzeichnerinnen sind überwiegend in Planungsbüros und Unternehmen der Bauwirtschaft sowie in Behörden tätig. Typische Einsatzfelder sind - analog zum gewählten Schwerpunkt - der Architekturbereich, der Ingenieurbau sowie der Tief-, Straßen- und Landschaftsbau. Bauzeichner bzw. Bauzeichnerinnen arbeiten einzeln und im Team an der inhaltlichen Realisierung von Bauprojekten. Auf der Basis moderner Technologien und unter Nutzung branchentypischer Software fertigen sie Zeichnungen auf der Basis baurechtlicher Vorschriften für die Planung und Bauausführung an, auch unter den Aspekten des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Neben den zeichnerischen Tätigkeiten sind sowohl rechnerische als auch organisatorische Tätigkeiten selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildung dauert drei Jahre; eine vorzeitige Zulassung zur Prüfung nach 2,5 Jahren oder eine Verkürzung auf zwei Jahre ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Ausbildungsinhalte
Ausbildungsinhalte sind u. a.:
- Organisation und Kommunikation, Arbeitsabläufe
- Zusammenarbeit mit Behörden und anderen am Bau Beteiligten
- Techniken des Zeichnens, rechnergestütztes Zeichnen
- Auswahl und Verwendung von Baustoffen und Bauelementen
- Mitwirken bei Bauprozessen und Durchführen von Bauarbeiten
- Konstruieren von Bauteilen
- Bestandsaufnahme und Vermessung
- Erstellen von Plänen und fachspezifischen Berechnungen
Unterricht
Der Unterricht wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in vierzehn praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den drei Bündelungsfächern Bauentwurfsplanung, Baukonstruktionen und Bauausführungsplanung organisiert. Im 1. und 2. Ausbildungsjahr sind die ersten neun Lernfelder für die Bereiche Architektur, Ingenieurbau und Tief-, Straßen- und Landschaftsbau gleich. Die Unterteilung in die drei Schwerpunkte beginnt mit dem 3. Ausbildungsjahr.
Lernfelder:
- Mitwirken bei der Bauplanung
- Aufnehmen eines Bauwerkes
- Erschließen eines Baugrundstücks
- Planen einer Gründung
- Planen eines Kellergeschosses
- Konstruieren eines Stahlbetonbalkens
- Konstruieren von Treppen
- Planen einer Geschossdecke
- Entwerfen eines Dachtragwerkes
Schwerpunkt Architektur
- Erstellen eines Bauantrages
- Entwickeln einer Außenwand
- Planen einer Halle
- Konstruieren eines Dachaufbaues
- Ausbauen eines Geschosses
Schwerpunkt Ingenieurbau
- Sichern eines Bauwerks
- Entwickeln einer Aussenwand
- Planen einer Halle
- Konstruieren eines Daches
- Planen eines Stahlbetonbauwerkes
Schwerpunkt Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
- Ausarbeiten eines Straßenentwurfs
- Konstruieren eines Straßenoberbaus
- Planen einer Wasserversorgung
- Planen einer Wasserentsorgung
- Planen einer Außenanlage
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Um einen möglichst großen Praxisbezug herzustellen, findet der Fachunterricht in einem PC-Raum statt, in dem insgesamt 27 CAD-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, die mit dem Zeichenprogramm Allplan ausgestattet sind.
Besonderheiten
In jedem Jahr absolvieren mehrere Gruppen von in der Regel fünf Bauzeichnern bzw. Bauzeichnerinnen ein dreiwöchiges Auslandspraktikum in Norwegen, um dort u. a. die Holzrahmenbauweise kennenzulernen. Die Vor- und Nachbereitung der Aufenthalte erfolgt durch die Stiftung Bildung und Handwerk in Paderborn, die die Praktika im Rahmen von Erasmus+ auch finanziell fördert.
Elektroniker*in für Betriebstechnik
Autor: Fretter, ESB

Berufsbild
Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik installieren elektrische Komponenten und Anlagen in Bereichen wie der Energieversorgung, industriellen Betriebsanlagen sowie der Gebäude- und Automatisierungstechnik. Sie planen Änderungen und Erweiterungen von Anlagen, verlegen Leitungsführungssysteme und Energiekabel, richten Maschinen und Antriebssysteme ein und montieren Schaltgeräte. Darüber hinaus programmieren, konfigurieren und prüfen sie Systeme und Sicherheitseinrichtungen. Sie überwachen die Anlagen, führen regelmäßige Wartungen und Prüfungen durch und beheben Störungen.
Ebenso organisieren sie die Montage von Anlagen und koordinieren die Arbeit von Dienstleistern und anderen Gewerken. Bei der Inbetriebnahme weisen Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik die zukünftigen Nutzer in die Bedienung der Anlagen ein.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre und kann unter bestimmten Voraus-setzungen auf bis zu zweieinhalb Jahre verkürzt werden.
Ausbildungsinhalte
- Installation von Leitungsführungssystemen
- Montage von Schaltgeräten
- Einrichtung von Antriebssystemen und Maschinen
- Prüfung, Programmierung und Konfiguration von Schaltsystemen und Sicherheitseinrichtungen
- Überwachung und Wartung von Anlagen
- Reparatur von Störungen
- u.a.
Unterricht
Der Unterricht in den ersten drei Ausbildungsjahren erfolgt als Blockunterricht, dabei beträgt die Blocklänge 3 bzw. 4 Wochen mit einem Abstand von 6 bis 10 Wochen. Im 4. Aus-bildungsjahr findet der Unterricht in Teilzeitform mit einem Unterrichtstag pro Woche statt. Die Unterrichtsinhalte werden in 13 praxisnahen Lernfeldern vermittelt und sind in zwei Bündelungsfächern „Errichten und Betreiben von Energieverteilungs- und Gebäudeanlagen“ und „Errichten und Betreiben automatisierter Anlagen“ organisiert.
Lernfelder:
- Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen
- Elektrische Installationen planen und ausführen
- Steuerungen analysieren und anpassen
- Informationstechnische Systeme bereitstellen
- Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten
- Geräte und Baugruppen in Anlagen analysieren und prüfen
- Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren
- Antriebssysteme auswählen und integrieren
- Gebäudetechnische Anlagen ausführen und in Betrieb nehmen
- Energietechnische Anlagen errichten und in Stand halten
- Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen und in Stand halten
- Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren
- Elektrotechnische Anlagen in Stand halten und ändern
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt. Dabei kommen u.a.
- Prüfen und Messen nach DIN VDE 0600-100 (Errichten von Niederspannungsanlagen), DIN EN 50678 (VDE 0701/ Prüfung nach Reparatur) und DIN EN 50699 (VDE 0702/ Wiederholungsprüfung)
- Programmierung speicherprogrammierbarer Steuerungen mit Siemens SIMATIC S7-1500 und Programmierumgebung: STEP 7 (TIA Portal)
- CAD-Schaltungsentwurf mit SeeElectrical, FluidSIM bzw. Grafcet-Studio
zum Einsatz.
Fachinformatiker*in (verschiedene Schwerpunkte)
Autor: Fretter, ESB

Berufsbild:
Fachinformatiker*innen planen, entwickeln und testen Softwarelösungen und IT-Systeme für den eigenen Betrieb oder für Kunden. Sie analysieren Anforderungen, konzipieren Programme, setzen diese mithilfe moderner Programmiersprachen um und beraten bei der Auswahl und Integration von Hard- und Softwarekomponenten. Ebenso gehört die Inbetriebnahme, Installation, Schulung und Einweisung der Anwender sowie die Wartung und Pflege der Systeme zu den Aufgaben.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu 2 Jahre verkürzt werden.
Ausbildungsinhalte (können je nach Schwerpunkt variieren)
- Betriebswirtschaft und Arbeitsorganisation
- Programmierung
- Inbetriebnahme und Administration von IT-Systemen
- IT-Markt und Kundenorientierung
- Service und Support von IT-Systemen
- Konzeption von IT-Systemen
- Hardwarekomponenten von Arbeitsplatz- und Serversystemen
- Netzwerktechnik
- Grundlagen der Softwareentwicklung
- IT-Sicherheit
- Grundlagen Internet of things
- Wirtschafts- und Betriebslehre
Unterricht
Der Unterricht wird in Teilzeitform an einem bis zwei Tagen pro Woche in 12 praxisnahen Lernfeldern erteilt und ist in den drei Bündelungsfächern Gestaltung von IT-Dienstleistungen, Entwicklung vernetzter Prozesse und Softwaretechnologie und Datenmanagement
organisiert.
Lernfelder (können je nach Schwerpunkt variieren):
- Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben
- Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten
- Clients in Netzwerke einbinden
- Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen
- Software zur Verwaltung von Daten anpassen
- Serviceanfragen bearbeiten
- Cyber-physische Systeme ergänzen
- Daten systemübergreifend bereitstellen
- Netzwerke und Dienste bereitstellen
- Benutzerschnittstellen gestalten und entwickeln
- Funktionalität in Anwendungen realisieren
- Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren
- Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten
- Kundenspezifische Anwendungsentwicklung durchführen
Die Stundentafel wird ergänzt durch Unterricht in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre, Politik, Englisch, Religion und Sport/Gesundheitsförderung.
Der Fachunterricht findet in für einen möglichst großen Praxisbezug in speziellen Fachräumen statt. Dabei kommen u.a.
- Servervirtualisierung mit Hyper-V
- Netzwerk- und IoT-Simulation (Cisco Packet Tracer) und
- Entwicklung von cyberphysischen Systemen mit dem Raspberry PI
Die Ausbildungsvorbereitungsklassen



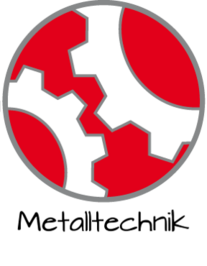
Die Ausbildungsvorbereitung (AV) und die Klasse für Schüler*innenohne Berufsausbildungsverhältnis (AVSO) bilden gemeinsam eine Berufseinstiegsphase, die den Übergang in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis erleichtern soll. Während der Schwerpunkt der Ausbildungsvorbereitung auf dem nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses liegt, ist die Klasse für Schüler*innen ohne Berufsausbildungsverhältnis stringenter auf eine duale Berufsausbildungsvorbereitung ausgerichtet. Die Dauer des Bildungsgangs ist auf ein Jahr beschränkt.
Ausbildungsvorbereitung AV
Die Ausbildungsvorbereitung zielt auf den Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9.
Gleichzeitig werden Kenntnisse und Fertigkeiten aus mehreren Berufsfeldern vermittelt, sodass eine bessere Grundlage für die Berufswahl entsteht.
Klasse für Schüler*innen ohne Berufsausbildungsverhältnis AVSO
Klasse für Schüler*innen ohne Berufsausbildungsverhältnis AVSO
Schüler*innen, die die Schulpflicht in der Sekundarstufe II (Berufsschulpflicht) noch nicht erfüllt haben und sich nicht für einen anderen Bildungsgang entscheiden, besuchen die Klassen für Schüler*innen ohne Berufsausbildungsverhältnis.
Die Jugendlichen dieser Klasse erwerben berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten, die auf eine betriebliche Ausbildung vorbereiten und ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt oder dem Arbeitsmarkt verbessern.

